Oder: Wie du mit Geld, NGOs und einem freundlichen Lächeln ein ganzes Land „rettest“
In einer Welt, in der Superreiche mit einem Tweet die Börse bewegen und mit einem Scheck Bildungssysteme „verbessern“, ist eines sicher: Geld ist nicht nur Macht – Geld ist PR, Politik und Philanthropie in einem. Aber was passiert, wenn diese drei Bereiche verschwimmen? Spoiler: Dann wird die Welt nicht unbedingt besser, aber definitiv interessanter.
Kapitel 1: Erst der Ruf, dann die Rettung
Früher war es ganz einfach: Milliardäre kauften Fußballvereine oder Casinos, um sich ein besseres Image zu basteln. Heute ist das zu plump. Wer heute ernst genommen werden will, gründet eine Stiftung, bezahlt ein paar Think-Tanks und spendet an NGOs, die auf Konferenzen in Davos und Nairobi mit Hochglanzbroschüren die Menschheit verbessern wollen.
Ein Paradebeispiel? Bill Gates. Der Mann, der in den 90ern wegen Microsofts Monopolstellung verklagt wurde, ist heute die personifizierte Wohltätigkeit. Mit der Bill & Melinda Gates Foundation hat er Milliarden in Impfstoffe, Bildung und Landwirtschaft investiert – und dabei ganz nebenbei auch in Unternehmen, die genau davon profitieren.
Und wer berichtet darüber? Die Medien – viele davon direkt oder indirekt durch Stiftungszuschüsse, gesponserte Rechercheprojekte oder Medienpreise freundlich gestimmt. Kritik? Nur von ganz hartnäckigen Investigativteams – oder Leuten mit Aluhut, was natürlich praktischerweise jede Debatte gleich disqualifiziert.
Quellen:- Gates Foundation Investments: https://www.gatesfoundation.org/about/how-we-work/investment-philosophy– Kritik an Gates: The Nation (https://www.thenation.com/article/society/bill-gates-philanthropy/)- Medienfinanzierung: Columbia Journalism Review (https://www.cjr.org/criticism/gates-foundation-journalism-funding.php)
Kapitel 2: NGOs – die neuen Diplomaten
Früher schickten Regierungen Botschafter. Heute schicken Milliardäre NGOs. Sie heißen dann „Open Society“, „Earth Fund“ oder „Education First“ – alles sehr sympathisch, sehr humanitär. Und sie treten in Ländern auf, als wären sie der verlängerte Arm des Guten – dabei vertreten sie vor allem eines: Interessen.
George Soros ist das bekannteste Beispiel: Mit seinem Netzwerk aus Stiftungen und Initiativen unterstützt er demokratische Bewegungen, kritische Medien und zivilgesellschaftliche Organisationen – oft mit dem Effekt, dass autoritäre Regierungen sich untergraben fühlen. In Ungarn wurde seine Stiftung sogar des Landes verwiesen. Klar, für viele ist er ein Held der offenen Gesellschaft. Für andere ist er einfach ein Global Player mit politischer Agenda.
Auch Jeff Bezos hat mit seinem Bezos Earth Fund versprochen, den Klimawandel zu bekämpfen – mit 10 Milliarden Dollar. Beeindruckend! Weniger beeindruckend: Dass Amazon gleichzeitig einer der größten CO2-Produzenten der Welt ist, Arbeitsbedingungen wie in der Dampfmaschinenära herrschen, und Steuervermeidung als Leistungssport betrieben wird.
Quellen:- George Soros’ Open Society Foundations: https://www.opensocietyfoundations.org/- Konflikte mit Ungarn: BBC (https://www.bbc.com/news/world-europe-42682222)- Bezos Earth Fund: https://www.bezosearthfund.org/– Amazon CO2-Fußabdruck: The Guardian (https://www.theguardian.com/technology/2021/jul/30/amazon-carbon-emissions-rise)
Kapitel 3: Medien – Kaufen oder Fördern, Hauptsache Kontrolle
Ein bewährter Trick: Wenn du nicht willst, dass negativ über dich berichtet wird, kaufe einfach das Medium. Oder finanziere Recherchestipendien. Oder stifte einen Journalismuspreis.
Beispiel Elon Musk: Der Mann mit Raketen, Robotern und Twitter. Äh, „X“. Er kaufte die Plattform angeblich für die Meinungsfreiheit – und sperrt seither regelmäßig Journalisten, die kritisch über ihn schreiben. Das ist Meinungsfreiheit 2.0: Frei für alle, die zustimmen.
Oder nimm Mark Zuckerberg, der mit seiner Chan-Zuckerberg-Initiative Milliarden in Bildung steckt – während Facebook (äh, Meta) gleichzeitig maßgeblich zur Verbreitung von Fake News, Verschwörungstheorien und Desinformation beigetragen hat. Da fragt man sich: Ist es Reue? Oder nur ein Imagepolitur-Abo?
Quellen:- Elon Musk und Twitter/X: New York Times (https://www.nytimes.com/2022/11/18/technology/elon-musk-twitter-journalists.html)- Mark Zuckerberg: The Guardian (https://www.theguardian.com/technology/2020/mar/17/facebook-mark-zuckerberg-education-donation-analysis)
Kapitel 4: Wohltätigkeit mit Bedienungsanleitung
Besonders perfide: Wenn „Spenden“ an Bedingungen geknüpft sind. In manchen afrikanischen Ländern wurden Bildungsprogramme nur finanziert, wenn bestimmte Inhalte gelehrt wurden – gerne in englischer Sprache, mit US-orientierter Perspektive, und manchmal ganz zufällig im Einklang mit den Interessen westlicher Unternehmen.
Auch in der Landwirtschaft ist das beliebt: Hilfsprojekte bringen neue Saatgutsysteme – die man dann regelmäßig bei einem bestimmten Konzern nachkaufen muss. Genial! Man schenkt dir eine Angel, aber nur wenn du den Fisch jedes Mal beim Schenker kaufen musst.
Quellen:- Bildungsprogramme mit Bedingungen: Al Jazeera (https://www.aljazeera.com/features/2017/3/20/the-problem-with-aid-dependent-education)- Saatgutsysteme in Afrika: The Intercept (https://theintercept.com/2019/12/29/gates-foundation-africa-agriculture/)
Kapitel 5: Warum das alles problematisch ist (trotz nettem Lächeln)
Natürlich ist nicht jede Spende manipulativ. Natürlich sind nicht alle NGOs böse. Und natürlich gibt es echte, ehrliche Philanthropie.
Aber wenn ein Mensch mit seinem Privatvermögen in Bildungssysteme, Gesundheitspolitik oder internationale Beziehungen eingreift – Dinge, über die sonst Parlamente abstimmen – dann muss man die Frage stellen: Wer kontrolliert das? Wer prüft, ob die Interessen der Menschen vor Ort wirklich im Mittelpunkt stehen – oder nur das Weltbild eines sehr reichen, sehr einflussreichen Einzelnen?
Quellen:- Kritik an unregulierter Philanthropie: Stanford Social Innovation Review (https://ssir.org/articles/entry/when_philanthropy_meets_politics)- Steuervermeidung und Reichtum: ProPublica (https://www.propublica.org/series/the-secret-irs-files)
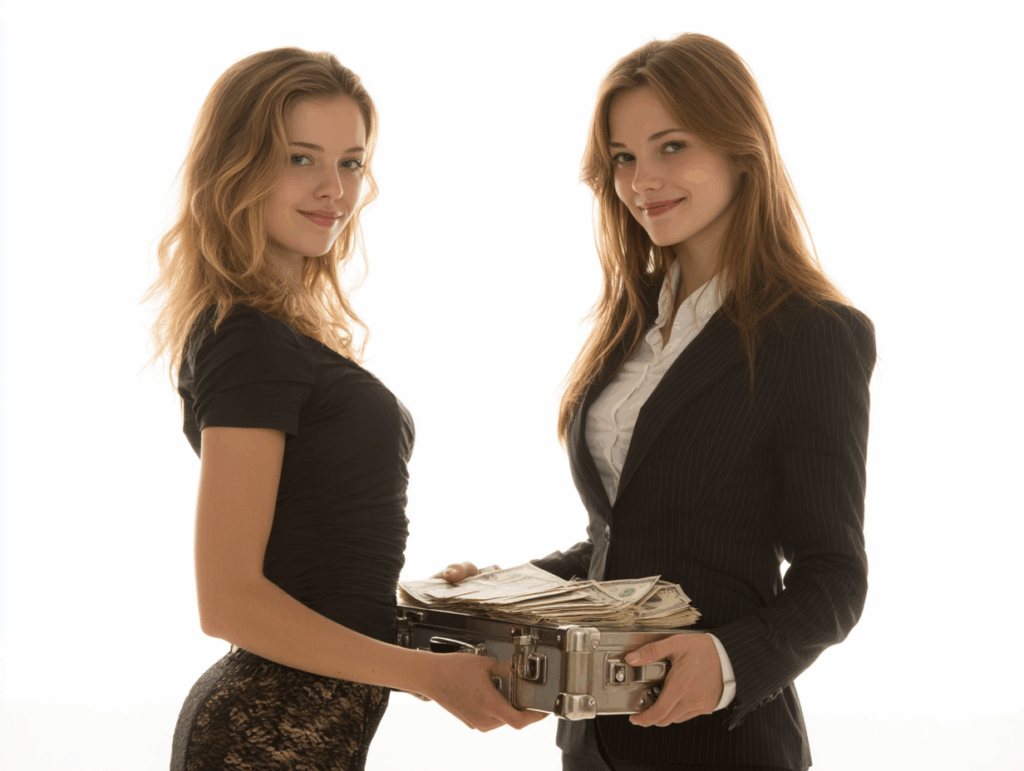 Bild: Ki Illustration © https://gedankenschleife.net
Bild: Ki Illustration © https://gedankenschleife.netFazit: Mehr Kritik, weniger Applaus
Gute Taten sind nicht weniger gut, nur weil sie auch Eigeninteresse enthalten. Aber sie verdienen mehr kritische Begleitung und weniger blinde Bewunderung. Milliardäre sind keine neutralen Retter. Sie sind Akteure mit Interessen, Netzwerken – und mächtigen Werkzeugen.
Vielleicht wäre es besser, sie würden einfach mehr Steuern zahlen, statt sich als Helden zu inszenieren. Dann könnten demokratisch gewählte Regierungen entscheiden, wo das Geld am dringendsten gebraucht wird – und nicht PR-Berater mit Weltenretter-Komplex.
